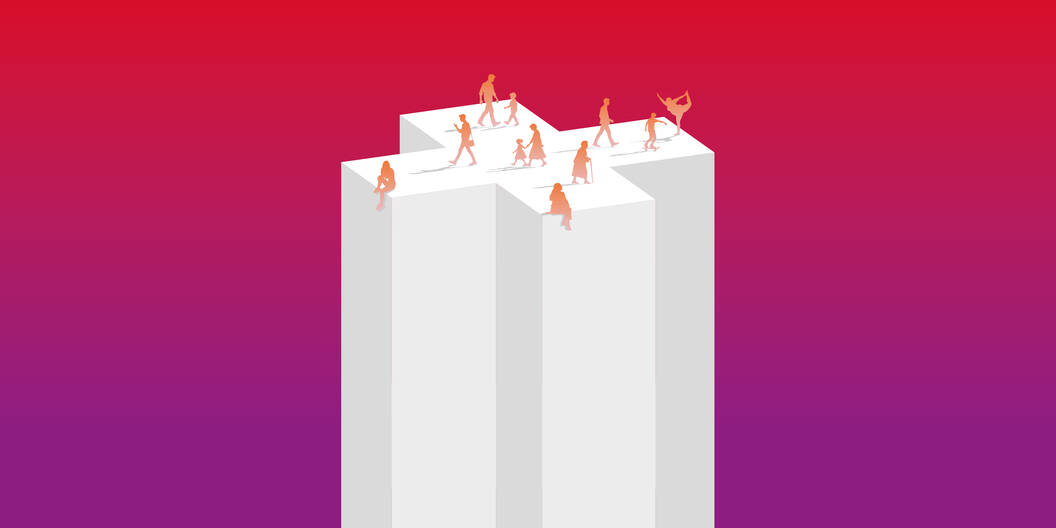News und Storys Beiträge im Fokus
Was Ihre Spende bewirkt
0
Personenbesitzen eine KulturLegi und haben so Rabatt für Kultur und Sport
(2024)
0
Beratungenkonnte die SOS-Schuldenberatung durchführen
(2024)
0
Projektezur Armutsbekämpfung weltweit
(2024)
0
Personenhaben direkt von einem Projekt profitiert
(2024)
Ausgewählte ProjekteEngagement für eine Welt ohne Armut
Unser Ziel
Eine Welt ohne Armut
Armut zu verhindern, zu bekämpfen und zu lindern – mehr noch, Armut zu beenden, überall und für alle: Das ist der Grundauftrag der Caritas, dem sie seit ihrer Gründung im Jahr 1901 verpflichtet ist. Das Ziel – eine Welt ohne Armut – ist immer dasselbe, aber die Wege dorthin passen sich den Bedürfnissen an.
Wenn Armut ihr Gesicht zeigtPorträts aus der ganzen Welt
Titelbild: Steinmauern schützen Felder vor Bodenerosion. © Fabio Biasio