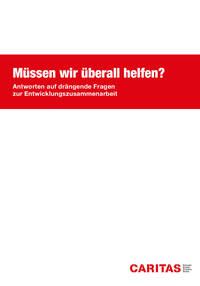Entwicklungszusammenarbeit
Die Caritas ist überzeugt: Gute Entwicklungszusammenarbeit ist heute wichtiger denn je. Wir zeigen Ihnen, warum und laden zur Diskussion ein.
In den letzten Jahren hat sich das Leben für unzählige Menschen auf der Welt verbessert. Trotzdem bleiben viele Menschen bitterarm und ohne Perspektiven. Der Hunger ist nicht aus der Welt geschafft und sauberes Wasser bleibt ein Privileg.
Welche Rolle kann die Entwicklungszusammenarbeit in der Armutsbekämpfung und der Herstellung von sozialer Gerechtigkeit spielen? Und inwiefern steht unser Land in der Verantwortung, sich zu engagieren? Solche Fragen beschäftigen die Politik und die Gesellschaft immer mehr.
Für die Caritas Schweiz ist klar: Es ist gut, dass wir über Entwicklungszusammenarbeit reden! Ja, wir sollten das noch viel häufiger tun. Eine breite Diskussion in der Öffentlichkeit ist wichtig, damit wir die Chancen und Grenzen der Entwicklungszusammenarbeit besser verstehen, und damit sich die Entwicklungszusammenarbeit weiterentwickeln kann.
Caritas Schweiz gibt Antworten. In einer übersichtlichen Broschüre nehmen wir insgesamt 46 drängende Fragen zur Entwicklungszusammenarbeit auf. Zum Beispiel:
10 ausgewählte Antworten
Diskutieren Sie mit uns auf den Sozialen Medien
Die Caritas ist überzeugt: Gute Entwicklungszusammenarbeit ist ein zentrales, unverzichtbares Instrument bei der Bekämpfung von Hunger, Armut, Ungleichheit. Und angesichts der Klimakrise oder der oft menschenunwürdigen Migration ist sie heute wichtiger denn je: Solche globalen Herausforderungen brauchen gemeinsame Lösungen. Nur zusammen können wir sie bewältigen. Was denken Sie?
Weitere Informationen
Titelbild: Haïti © Rafaelle Castera